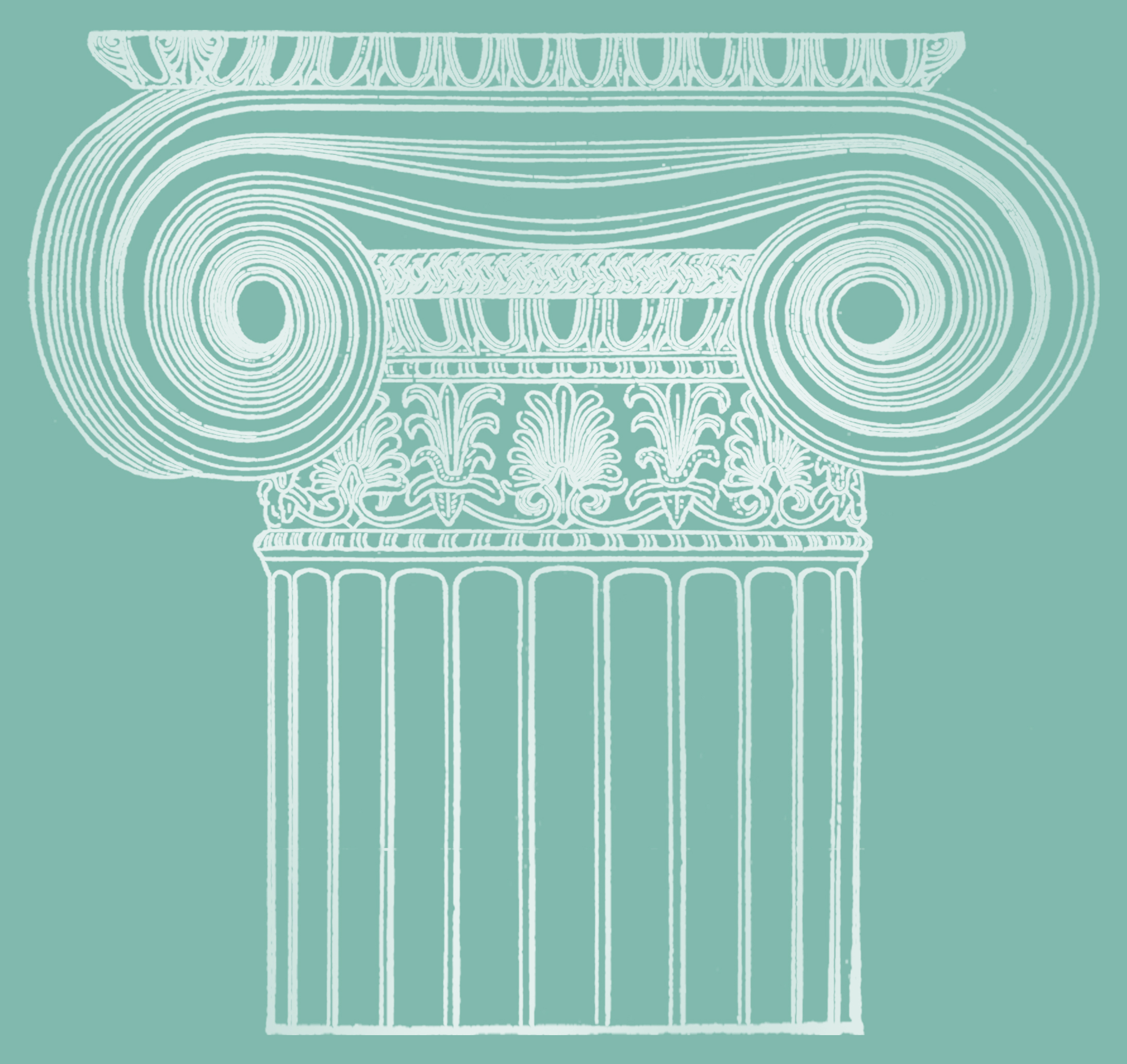Pichler & Traupmann
VOM KONTINUUM DES RAUMES MIT ECKEN, KANTEN
Wien, 3. Bezirk, Weyrgasse 6, am 10. Jänner 2014 punkt 12.00 Uhr: Zwei schwarz gekleidete Architekten sitzen an einem weißen Tisch mit weißen Plastikstühlen von Verner Panton in einem hohen, weiß ausgemalten Büroraum ihres Ateliers im Gespräch mit Peter Reischer. Die erste Frage ist somit aufgelegt:
Sehr geehrte Herren Architekten, wie schon Cordula Rau stelle ich dieselbe Frage: „Why do architects wear black?“ Begeben Sie sich bewusst in dieses Klischeebild des Architekten oder ist das eine Stammestracht?
Pichler: Otto Kapfinger hat damals geantwortet: „Das ist Funktionskleidung und man muss jeden Tag eine Idee zu Grabe tragen.“
Und welches ist Ihre Antwort?
Traupmann: Meine Antwort ist die, dass ich in der Früh nicht jeden Tag auch über die Kleidung nachdenken muss. Sie ist somit wie ein Ordensgewand, das ja auch den Sinn gehabt hat, sich nicht von den täglichen Kleinigkeiten ablenken zu müssen. Schwarz ist etwas Kathartisches, man muss sich nicht besonders exponieren und es strahlt eine gewisse Eleganz aus. Schwarz ist auch damit konnotiert, in der Kunstszene verankert zu sein. Es gibt bei den Architekten eben die ‚Jägerleinenfraktion‘ und die ‚schwarze Fraktion‘.
P: Schwarz ist auch mit dem Überbegriff Kunst, Innovation verbunden und offenes Denken, Experimente, Impulse zählen zu den Aufgaben eines Architekten.
Herr Architekt Traupmann, Sie haben zuerst Theologie studiert und dann Architektur. Wie kommt man aus der Theologie zur Architektur? Wie kommt ein solcher Wechsel zustande?
T: Für mich gibt es eine sehr große Kohärenz in einem Überbegriff, den man als eine Annäherung an die Wirklichkeit bezeichnen könnte. Es geht, darum Dinge zu ergründen. Dem kann ich denkerisch, rein spekulativ oder intellektuell begegnen und ein System daraus entwickeln, das ich dann Religion oder Theologie nenne.
Religion beruht doch weniger auf Ergründen als auf Glauben?
T: Das mit dem Glauben stimmt schon, aber es gibt die Phase, wo man aus dem vorwissenschaftlichen (Denken) herauskommt und den Dingen systematisch auf den Grund gehen will. In der Kunst ist es ähnlich, da gibt es Parallelen. Es gibt emotionale Zugänge zu Glaube, Religion, Atmosphärischem, zu Environment, Design und Architektur, Raum und Farbe. Irgendwann stellt man sich die Frage, nach dem, was hinter den Dingen liegt und beginnt das zu erforschen. Das kann man in der Theologie ergründen - in der Architektur ist es ähnlich. Man beginnt Systeme zu entdecken, diese für sich zu gewinnen und mit ihnen später zu arbeiten. Für mich gibt es in der Architektur verschiedene Denk- und Forschungsmuster, die im Bereich des Theologisch-Philosphischen angesetzt sind. In der weiteren Ausformulierung bleibt das dann der Sprache oder dem tieferen Denken verbunden, weniger dem Tun.
Würden Sie gerne eine Kirche bauen?
T: Das wäre eine schöne und lohnenswerte Aufgabe.
P: Architektur ist immer in irgendeiner Form Abbild des Weltbildes einer Gesellschaft. Die Kunstgeschichte beschreibt verschiedene Weltbilder, verschiedene Kulturen und mich hat immer dieser Ausdruck eines zunehmend komplexen Weltbildes - das wir mittlerweile haben - fasziniert. Was bewirken die neuen Strömungen, wie zum Beispiel Chaos und Komplexität, in der Ausdrucksweise von Kunst und Architektur? Sind wir als Schaffende in der Lage, das zu transformieren? Diese Frage hat eine viel größere Unmittelbarkeit oder Bedeutung.
Was ist jetzt unsere Gesellschaft im Bezug zur Architektur?
T: Ich würde das nicht auf das Phänomen Gesellschaft beschränken, die dahinterliegenden Systeme sind ja keine reinen Abbilder der Gesellschaft, sondern auch Modelle, die zwar ausgedacht aber noch nicht wirksam werden. Als Architekt interessiert man sich für Chaostheorien und Ähnliches, immer mit der Frage, was daraus abzuleiten sei, um es architektonisch auszuformulieren. Natürlich hofft man auch auf eine Rückkopplung in die Gesellschaft. Es geht nicht nur um rein soziologische Prozesse, sondern auch um spekulative. Beide Komponenten sind für eine qualitätsvolle Architektur wichtig. Sonst ist Architektur eine reine Dienstleistung. Wir wollen aber genau um eine Spur mehr und das macht die Architektur als Kunst aus.
Wo steht jetzt die Gesellschaft, welche Auswirkungen hat die Architektur auf sie?
T: Ich persönlich betrachte es als ein sehr stark kommunikationsbetontes, offenes System, das sich in den verschiedensten Bereichen der Lebensvollzüge Möglichkeiten zu eröffnen versucht. Das Offenhalten von Prozessen und dem folgend auch von Räumen. Das ist ein wesentlicher Faktor, der in der Architektur zu bewerkstelligen ist. Es ist das ‚dazwischen‘, so haben wir das immer bezeichnet. Architektur muss diesen Spielraum bieten.
P: Architektur kann auch Gegensätze auflösen.
Wir reden heute von der Postmoderne, vom Dekonstruktivismus als Vergangenes. Wie wird man in 20 Jahren unsere Architektur benennen?
P: Es gibt auch schon den Begriff der ‚Rezeption der Moderne‘. Für mich war es - als Student - ein Schock zu erleben, dass es die Postmoderne gibt. Ich habe als Gymnasiast Corbusier und Mies van der Rohe entdeckt. Das hat mich berührt - und dann zu sehen, dass die großen ‚Meister‘ das über Bord zu werfen beginnen, um eine rückwärts gewandte Architektur zu machen ...
... mit Säulchen und Giebelchen und Scheinfassaden ...
... ja, das war ein Schock. Wir waren die erste Studentengeneration, die versucht hat, die Postmoderne postmodern sein zu lassen und dagegen aufzubegehren.
T: Ich habe mich in meinem Studium besonders mit den ‚New York Five‘ beschäftigt. Für mich waren das wahnsinnige Impulse. Projekte habe ich aus diesem Geist heraus gemacht.
In 20 Jahren wird man sicher unsere Zeit als ‚Parametrismus‘ bezeichnen. Wir haben momentan eine Gesellschaftsstruktur, die von vielen Faktoren bestimmt wird oder werden kann. Parametrismus bedeutet ja nichts anderes als ein responsives System, in dem man versucht, Dinge in ihren Abhängigkeiten zu verstehen und zu erklären. Und dann daraus steuerbare, architektonische Modelle zu entwickeln. Wie dieser Begriff dann - auch formal - realisiert (?renaissiert?) werden wird, ist eine andere Sache. Unserer Architektur des Offenhaltens von Systemen, die ein gewisses Potenzial eröffnen und verschiedene Verhaltens- und Gestaltungsmuster zulassen, lässt sich vielleicht in einem Überbegriff auch im Parametrismus einordnen, ohne dass wir eine strenge Parametrismusschule im Sinne von Surface-Parametrismus sind.
Warum lehnen viel Architekten diese Entwurfsmethode ab? Sie sagen, der Mensch wird aus dem Entwurfsprozess verbannt.
P: Da muss man die klassische Moderne betrachten. Die Moderne hatte ja damals tatsächlich auch den Wunsch, den Autor auszuradieren, aus gesellschaftspolitischen Gründen. Architektur sollte ein reiner gesellschaftlicher Ausdruck sein. Natürlich kann man darauf sagen, dass das schlecht ist, weil der Mensch mit seinen Fähigkeiten inkludiert sein soll. Aber der Autor ist ja nicht nur einfach das Genie, das aus sich selbst schöpft, sondern er hat layerweise in sich Informationen gestapelt, historische Vorbilder und Bilder, die er bewusst oder unbewusst weiterverwendet.
In der Natur gibt es ja auch eine unbeschreiblich große Anzahl von Einflussfaktoren, die ein Spannungsfeld bewirken. Wenn jetzt ein Auslöser, ein Aktor dazu kommt - entsteht eine Pflanze oder ein Tier quasi ‚von selbst‘. Diese Kreation ist absolut authentisch und einem Wahrheitsbegriff unterworfen. Und die Natur generiert die wunderschönsten Formen. Da wir heute die Möglichkeiten des Computers haben, kann man solche Dinge, die man vor Jahrzehnten nur theoretisch angenommen hat, auch simulieren. Aber ohne dass wir als Entwerfer bewusst eingreifen - passiert gar nichts.
T: Komplexe Wirklichkeiten sind iterative Prozesse, die sich entwickeln. Man hat eben heute Tools entwickelt, um diese verschiedenen Parameter zu begreifen, zu beherrschen und mit ihnen zu arbeiten. Ich erkenne Systeme und habe parallel dazu ein ‚digital tooling‘ mit dem ich diese Dinge abbilden kann. Aber was ich damit mache, bestimme immer ich. Wo ich die Parameter einsetze, um dann in - einem möglicherweise prozesshaften - Zugang, die Veränderungen zu beobachten, entscheide ich als kreatives, geistiges Wesen. Sonst wäre der Entwurf ja ein reines, abstraktes Optimierungsverfahren.
Sie sehen also die Kontrolle und die Beherrschbarkeit dieser Vorgänge durch den menschlichen Geist und seine Kreativität.
T: Es gibt Werkzeuge, die ein größeres Potenzial haben, um Prozesse mitzugestalten. Gestalten müssen aber wir sie. Die Linie vom Kopf zur Hand zum Zeichenblatt ist ja nicht ausgeblendet.
Manche dieser Architekturen, die heute generiert werden, sind doch in ihrer Komplexität, Durchdringung, Ausformung, amorphen Erscheinung für einen Normalsterblichen (ohne Computer) nicht mehr vorstellbar?
P: Es gibt auch aus der Vorcomputerzeit amorphe Architekturen: die Oper in Sydney, TWA Airport in New York, Bauten von John Lautner usw. Wie ich 1990 nach Amerika gekommen bin, sind alle Computerfreaks dabei gewesen, Renaissancepavillons zu modellieren. Weil es so viele, fein ziselierte Details in der historischen Architektur gab.
Natürlich gibt es Auswüchse, die ich sehr kritisch sehe. Wenn es zum Beispiel nur wuchernde, krebsgeschwürartige Strukturen sind - das finde ich extrem abstoßend. Deswegen schaut ja auch unsere Architektur nicht so aus. Bevor der Raum ‚gehüllt‘ wird und dem Nutzer zur Verfügung steht, setzen wir schon manchmal einen bewussten Schlusspunkt im Programm, bevor es eben zu einer ‚Fetischisierung‘ des hundertfach durchgekneteten Objektes kommt.
T: Ich glaube, dass man eine Schichte mehr hinter diese Oberfläche blicken muss, um die Komplexität der Systeme zu sehen.
Kann der Normalsterbliche das? Eine Schicht dahinter blicken? Oder bleibt ihm das Geheimnis, der Sinn der Konstruktion und der Architektur verborgen?
T: Das glaube ich nicht, denn dann bräuchten wir keinen Kirchenraum.
Warum?
T: Weil die räumliche Komponente, die in einem Kirchenraum ausgedrückt wird, ein gewisses Verhaltensmuster bei dem, der den Raum betritt, evoziert, das erlebbar ist. Mit all den Dimensionen, die in einer räumlichen Tiefe da vergraben sind. (Vielleicht nicht bei jedem in der gleichen Intensität.)
Wenn ich mir die Architekturen, die in der östlichen Hälfte unserer Welt, fast im Wochenabstand entstehen und eröffnet werden, betrachte, weiß ich manchmal nicht, ob es sich um einen Bahnhof, ein Museum, ein Kulturzentrum, einen Sportpalast, ein Einkaufszentrum oder eine Oper handelt.
T: Wenn wir jetzt zur Typendiskussion gehen, ist das schon Teil der Veränderung im architektonischen Verständnis. Es gibt keinen klassischen bis klassizistisch geprägten Typus, der sich in Form eines klaren Inhaltes kommuniziert. Es gibt Systeme die - grundsätzlich architektonisch gesehen - multivalent sein müssten, die durch die Bespielung und Benutzung ihre Eigenschaften erfahren. Mit dem bewussten Ziel, Möglichkeiten und Potenziale offen zu lassen. Da hat die moderne Architektur sicher sehr stark in eine allgemeine, Richtung agiert. Das hat zu diesen abstrakten, weißen Raumfiguren geführt, die unterschiedliche Bespielungen ermöglichen. Das war durchaus bewusst und beabsichtigt.
P: Das beginnt ja schon in der Gründerzeit: Die historistische Architektur hatte ja ein symmetrisches Rastersystem. Das Wiener Rathaus könnte ein Rathaus, eine Kirche, ein Veranstaltungssaal oder auch die Fassade eines Bahnhofs sein. Diese nicht 1:1-Erkennbarkeit ist schon 150 Jahre alt und hat mit der Gesellschaft zu tun. Ich stehe diesem ewigen Wiederholten auch sehr skeptisch gegenüber. In 100 Jahren wird man die Architektur sicher so sehen, dass man Räume eben so gedacht hat: Sie wurden in kontinuierliche Bänder und Faltungen gehüllt. Das Kontinuum, das bewusst Grenzen von Wand, Boden, Decke verwischt, wird als eines der Stilmittel, als eine der Grundaussagen der Architektur der heutigen Zeit gesehen werden. Als prägend! Das hat mit der Rezeption von philosophischen bis naturwissenschaftlichen Modellen zu tun. Wenn man lernt, komplexe Systeme, die nicht mehr mathematisch linear abbildbar sind, zu begreifen - da sind unsere dreidimensionalen Schleifenstrukturen in Wirklichkeit primitiv.
Ihr Büro existiert schon seit 1992, also eher lange, über 20 Jahre.
Bekommen Sie Ihre Kunden, Ihre Aufträge größtenteils über Wettbewerbe?
T: Die großen Projekte sind fast alle über Wettbewerbe gekommen.
Wie sehen Sie der Problematik der Wettbewerbe für Architekten - gerade in Hinsicht auf die derzeit laufende Diskussion über die Sinnhaftigkeit, über verlorene und unbezahlte Leistung?
T: Grundsätzlich glaube ich, dass es ein sehr gutes Instrument zu Qualitätsteigerung ist. Das ist unbestritten. Die Frage ist nur der Umgang der anderen Beteiligten mit dieser Leistung. Wenn bei einem europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb mit 86 Teilnehmern am Ende alle Projekte in den Mistkübel wandern - ist das eine Sauerei. Das würde sich niemand bieten lassen, nur die Architekten lassen sich das gefallen. Mit der geistigen Leistung von Architekten wird eben nicht nachhaltig, sorgfältig umgegangen.
Was könnten die Architekten fordern, tun, um diesem Problem, das bei den Entscheidern liegt, zu entgegnen? Ein geladener Wettbewerb?
P: Da ist nur die Frage, wie lädt man die Teilnehmer. Da muss man ja auch in die Shortlist kommen.
Was ist mit einem Gremium, das eine Shortlist erstellt?
P: Da ist die Frage, ob man das institutionalisiert. Das Wichtigste ist - glaube ich - die Vorbereitung seitens der Bauherrenschaft und des Auslobers.
T: Die Bauherren müssen klug genug sein, das zu erkennen.
P: Und sie müssen auch dahinter stehen. Einen Wettbewerb als Versuchsballon zu starten, um zu schauen, was dabei herauskommt - das ist zum Scheitern verurteilt.
Was erwarten Sie sich vom Internet?
P: Sehr, sehr viel, es ist einfach DIE Kommunikationsplattform.
Ist das für den Architekten wichtig?
P: Wir haben in Vorinternetzeiten begonnen, und ich weiß noch, wie ich das erste mal ‚Informationen herunterladen‘ gehört habe. Was soll ich da herunterladen? Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen.
Das Internet ist ein kurzer, schneller Weg viele Leute zu erreichen. Wir drucken zwar immer wieder unsere Portfolios, das ist hübsch zum Blättern, aber einen Eindruck kann ich über das Netz viel schneller vermitteln.
Prinzipiell will man als Architekt doch Kunden gewinnen, oder Auftraggeber bekommen?
Ich möchte Sie mit einem Satz aus einer Website über Ihre Arbeiten konfrontieren:
Aufhebung und Gleichzeitigkeit sind Anspruch und Ziel fast aller Projekte von PxT. Dabei geht es in Absetzung von objekthaften Statements um die Leistung des Raumes und der den Raum generierenden Strukturen im Spannungsfeld zwischen scheinbaren Widersprüchen und Gegensätzen. Es geht um das Potenzial des ‚dazwischen‘, das sie als Spannungsfeld bearbeiten und das von PxT als Motor eines komplexen Transformationsprozesses betrachtet wird. Punkt!
Warum formulieren Architekten so kompliziert? Als Kunde laufe ich da davon.
P: Albert Einstein war begnadet im Formulieren. Seither hat es aber mehrere Symmetriebrüche gegeben und die Welt ist komplexer geworden. Wir versuchen mit der Komplexität mitzusurfen.
T: Architektur betrachten wir nicht nur als eindimensional, etwas das einem Auftraggeberwunsch oder seinen Kriterien unterworfen ist. Es steckt mehr dahinter, systematische und systemische Überlegungen. Unser Ziel ist es, Partner zu finden, die nicht nur eine pragmatische Lösung haben wollen, sondern mit denen wir spannende, komplexe, architektonische Projekte abwickeln können. Wir bieten über unsere Homepage, über die Bilder einen durchaus emotionalen Zugang, aber dann wollen wir auch Menschen ansprechen, die sich auch auf eine komplexe Debatte mit uns einlassen, die vielleicht durch unser systemisches Denken selbst einen Schritt weiter kommen. Jemand der mehr bekommt, als er erwartet hatte, mehr als die Erfüllung eines Raumprogrammes.
Wie hat sich Ihre Architektur über die Jahre entwickelt, verändert?
P: Im Rückblick auf Texte zu unseren Vorträgen im Jahr 1997, kann man sagen, dass wir inhaltlich, geistig damals schon sehr viel vorweggenommen haben. Etwas, das man uns damals formal noch nicht abgekauft hat. Nach einem Vortrag 1997 ist Hemma Fasch zu uns gekommen und hat gesagt, wenn ihr so über Architektur redet - warum sind eure Gebäude dann nicht anders, warum haben sie noch Ecken und sind nicht rund?
Und Otto Kapfinger hat dem später entgegnet: Wohl egalisieren ihre (PxT) Faltungen die alten Gegensätze von Wand und Decke, von Wand und Tür/Fenster. Die Werte von horizontal/vertikal, unten/oben bleiben für sie aber elementar und deshalb, so ihr starkes Argument, bringt gerade das Festhalten an rektangulären Formen in dialektischer Weise die Verflüssigung ihrer Gegensätze klarer zum Ausdruck als alles andere.
T: Vom System her, sind wir uns sicher treu geblieben. Wir bewegen uns immer im Bereich der phänomenalen Transparenz, der Schichtungen, Raumtiefen und des Kontinuums.
Das Wiener Architekturbüro Pichler & Traupmann wurde 1992 von Christoph Pichler und Johann Traupmann gegründet und hat seither vielfältige Bauaufgaben in den Bereichen Büro- und Industriebau sowie Bildungsbereich realisiert. Die Arbeiten im Wohnbau reichen von Villen über Einfamilienhäuser bis zum sozialen Wohnbau.
Christoph Pichler, geb. 1964, studierte Architektur an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien sowie an der Harvard University, USA. Seit 1992 unterrichtet er, zunächst als Universitätsassistent, ab 1996 (mit Unterbrechungen) als Lehrbeauftragter, an den Technischen Universitäten in Wien und Graz.
Johann Traupmann, geb. 1958, studierte Theologie in Wien sowie Architektur an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Seit 1992 unterrichtet er, zunächst als Lehrbeauftragter, seit 2002 als Assistenzprofessor, an der Universität für angewandte Kunst in Wien (Studio Zaha Hadid).