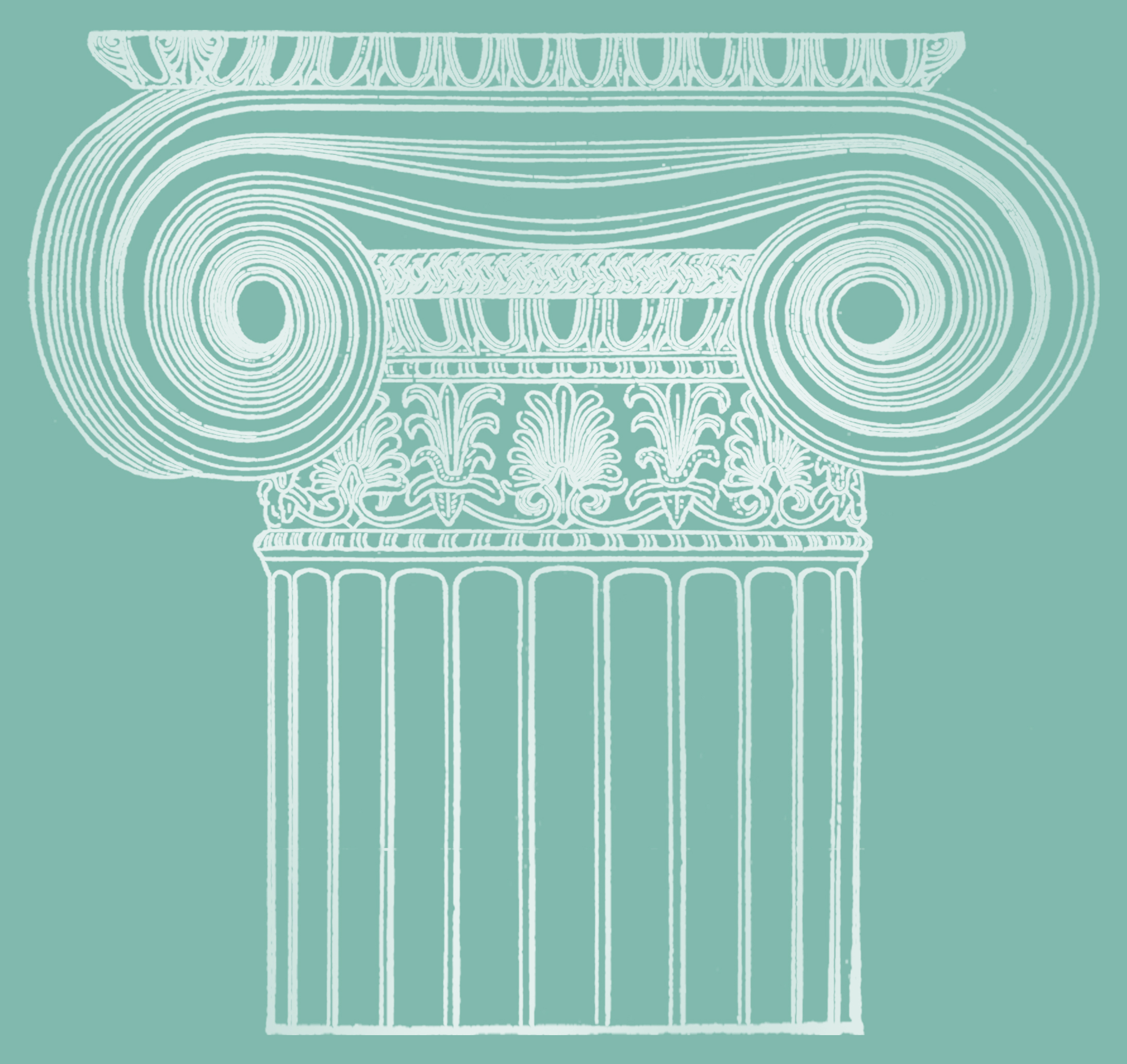PPAG architects
NEUTRALITÄT GIBT ES NICHT IN DER ARCHITEKTUR
Die PPAG architects haben in letzter Zeit einige Projekte realisiert, die auch internationales Aufsehen erregt haben. Peter Reischer besuchte sie in ihrem Büro und führte eine unerwartet kurzweilige Diskussion über Schulbau, öffentlichen Raum und über Wohnbau.
Findet in unseren Schulen eine Architekturvermittlung statt?
GP: Architektur vermittelt sich zu allererst einmal selbst. Die Frage muss schon früher ansetzen: Einem Team von Lehrern muss ein Bewusstsein mitgegeben werden. Das, was gelehrt wird, muss größer, umfassender gesehen werden. Es geht nicht um die Vermittlung irgendwelcher Fakten. Es geht nicht um 50 Minuten zuhören, sondern um andere Unterrichtsformen, die praktiziert werden müssen. Die Neugier der Kinder muss genutzt werden.
Gibt es Beispiele dafür?
GP: Wir reden nicht von Schulen, sondern von Bildungseinrichtungen, die schon vor der klassischen Schule ansetzen und auch den Kindergarten inkludieren.
AP: Das ist durchaus schon ‚state of the art‘. Für Architekten ist es interessant, dass das auch in den ‚ungünstigsten‘ Räumen funktioniert. Es hängt aber sehr von den vermittelnden Pädagogen ab.
Im Zuge unseres Bildungscampusauftrages haben wir uns im In- und Ausland und auch in Wien sehr viele Schulen angesehen und mit Pädagogen gesprochen.
GP: Der Raum – der dritte Pädagoge – spielt natürlich schon eine wesentliche Rolle. Von den Pädagogen haben wir immer gehört, dass sie auch an den Räumen scheitern. Ununterbrochen kämpfen sie mit ihren Schulgebäuden: Ein Tisch muss auf den Gang gestellte werden, weil er in der Klasse stört und wenn der Schulinspektor kommt, schnell wieder irgendwo hin verräumt werden, weil der Gang ja ein Fluchtweg ist.
Gibt es einen idealen Raumtypus für Schulen?
GP: Ideal - das ist der falsche Ansatz. Wenn man den Idealen fände, würde er ja dann Tausende Male reproduziert und dann gingen wieder alle in die gleiche Schule. Es gibt besser und schlechter geeignete Räume.
AP: Jedenfalls sollen sie Unterschiedliches ermöglichen und anbieten.
Kann man Strukturen und Regeln schaffen, in die Schule hineinpassen kann?
GP: Jein. Aber die Gesellschaft verfolgt zu jeder Zeit ein pädagogisches Konzept. Und aus diesem versuchen wir eine passende Bildungseinrichtung zu generieren.
AP: In Österreich wird, das über die Klasse - die ja jetzt nicht mehr Klasse, sondern ‚Bildungsraum‘ heißt - aufgezäumt. Es wird von den Pädagogen noch die Kernklasse vertreten. Das ist sozusagen die ‚homebase‘, die die Kinder auch brauchen. Es gibt andere Schulmodelle - in Dänemark - wo die Klasse aufgelöst oder in sehr kleine instruktive Einheiten atomisiert ist.
GP: In der Hellerup-Schule in Dänemark treffen sich um 8 Uhr in der Früh die 20 Schüler in einem kleinen ‚Kammerl‘. Der Lehrer sagt: „Was wollt Ihr heute tun? Ich schlage vor, wir arbeiten über Tiere.“ Dann fragt er jeden einzelnen Schüler, wie er das Thema zu bearbeiten gedenkt - Internet, lesen oder Bibliothek ... Die Kinder bekommen Aufgaben, schwärmen in der ganzen Schule aus, sind in einem Raumgefüge mit Kindern anderen Alters zusammen, suchen sich Mitarbeiter und treffen nach 2 - 3 Stunden wieder den Lehrer, um zu berichten.
Das ist natürlich ein sehr sozial orientierter Ansatz, so werden Beziehungen untereinander gestärkt und soziale Kompetenzen aufgebaut.
AP: Die älteren lernen von den jüngeren und umgekehrt. Hierarchien werden abgebaut, der Prozess verteilt sich natürlich über den ganzen Tag. Auch der Duktus des Stunde/Pause-Rhythmus wird aufgelöst, es ist einfach mehr Leben. Es ist nicht mehr die Aufbewahrungsanstalt, in die ich jeden Morgen gehe, sondern mein Lebensraum für viele Jahre.
GP: Wir reden jetzt aber immer von Ganztags- und Ganzjahresschulen!
Wie ist Ihr Zugang zum Schulbau?
GP: Vor einigen Jahren haben wir den Wettbewerb für den Bildungscampus Hauptbahnhof gewonnen. Das war der erste Wettbewerb, der anders ausgeschrieben war. Er hat nicht soundso viele Klassen und Quadratmeter verlangt, sondern die moderne Pädagogik beschrieben und die räumliche Umsetzung war – nur durch eine Gesamtfläche limitiert – gesucht.
Und wie sieht Ihr Resultat aus?
GP: Bei uns sind jeweils 4 Bildungsräume um einen Marktplatz, der Platz für Projektarbeiten und freies Arbeiten, auch altersübergreifend, bietet gruppiert. Dort, bei den Kindern, haben auch die Lehrer ihren Teamraum. Das Projekt wird heuer fertig.
Sie haben aber auch - neben dem Schulbau - viele Projekte im öffentlichen Raum (ÖR) gemacht?
AP: In dem Sinn, dass fast jedes Haus im ÖR steht, schon.
Was ist der ÖR für Sie? Der Begriff kommt ja von der Agora aus der Antike und sollte für jeden Bürger gleichermaßen öffentlich zugänglich sein.
AP: Ja, wir alle teilen uns den ÖR. Wenn sie das Haus verlassen und aus der Türe hinaus gehen - sind sie im ÖR. Es gibt noch genug in Wien.
Sie meinen die Straße! Versuchen Sie einmal einen Schritt auf den ÖR der Ringstraße zu machen - das werden Sie wahrscheinlich nicht überleben.
AP: Das ist ja das Kennzeichen des ÖR, dass ihn alle benutzen. Da gibt es gewisse Regeln, an die man sich hält. Er wird von unterschiedlichen Interessen benutzt.
Die Straße ist von den Autos und von den Radfahrern besetzt.
GP: Noch gibt es Autos. Und die Autofahrer beklagen jetzt beispielsweise, dass sie nicht mehr auf der Mariahilfer Straße fahren dürfen. Das ist aber auch demokratisch legitimiert, dieses Konfliktpotenzial müssen wir lernen kultiviert zu bewältigen.
AP: Der ÖR ändert sich dauernd und es wird durchaus gerade jetzt neuer ÖR von der Stadt Wien geschaffen. Zum Beispiel am WU Campus. Die Fußgängerzonen und Shoppingstraßen in Meidling oder in Favoriten, das sind großartige Räume mit sehr unterschiedlicher Färbung, je nachdem wie sich der Cocktail der Bewohner zusammensetzt.
Die Fußgängerzonen und Flaniermeilen in Wien sind - provokant gesagt - kein ÖR. Das sind rein von privaten und kommerziellen Interessen besetzte Räume. Shopping und Konsum als letzte öffentliche Betätigung?
AP: Aber ich muss ja nicht konsumieren. Wenn ich Sklave des Konsums bin - bin ich selber schuld. Ich poche auf einen gewissen Rest Eigenverantwortung im Menschen. Ich glaube doch, dass es eine Bewegung zur umfassenden Stadtnutzung gibt. Das Phänomen ist aber kein Problem der Einkaufsstraße, das ist ein Problem der Bildung, der Gesellschaft generell. Man kann die intelligentesten Dinge dumm benutzen.
Warum sind dann die Menschen so dumm?
AP: Das ist mir zu kulturpessimistisch! Das würde ich so nicht sagen.
Wenn Sie von der Gesellschaft auf die Architektur schließen - was haben wir dann heute für eine Architektur?
AP: Eine sehr, sehr vielfältige, aufgrund der vielen Inputs und Informationen, des weltweiten Einflusses. Wir sind ja eine ‚Architektenweltgemeinschaft‘, was andererseits wieder egalisierend wirkt.
Wo geht unsere Architektur hin? ‚Das globale Dorf‘ (Marshall McLuhan)?
AP: Ich finde nicht, dass die Architektur zu einem Einheitsbrei wird, der überall stehen könnte. Eigentlich empfinde ich das Gegenteil. Man hat noch nie in der Architektur so viel Informationen wie heute verarbeiten können. Ich empfinde die Architekten als die Dompteure, die das alles bändigen. Nicht als diejenigen, die einfach irgendetwas im Sinn der Selbstverwirklichung hinbauen.
Ist nicht gerade im Wohnbau - sie machen ja viel Wohnbau - dieses ‚nicht-sich-selbstverwirklichen‘ sehr wichtig? Der Wohnbau ist ja für einen Nutzer.
GP: Wohnarchitektur soll mehr als unauffällig oder neutral sein, sie soll enthusiastisches Wohnen unterstützen. Sie soll motivierend sein.
AP: Sie soll auch eine neue Art zu leben, zu wohnen anregen. Wir glauben nicht an das Neutrale. Das empfinde ich als faule Ausrede der Architekten. Neutralität gibt es nicht in der Architektur. Alles ist ein Statement, darum kommt man nicht herum.
Sie haben eine andere Wohnform erwähnt. Ist Ihr Projekt ‚Orasteig‘ ein Versuch, eine Alternative zum sozialen Wohnbau zu bilden?
AP: Alle unsere bisherigen Wohnbauten in Wien sind sehr unterschiedlich. Wir haben kein Programm dafür, wie Wohnbau ausschaut. Ein Inhalt des ‚Orasteig‘ war, Menschen, die eigentlich gerne ein Einfamilienhaus hätten, mit einer komprimierteren Form des Wohnens Zufriedenheit zu ermöglichen. Eine Alternative zum Einfamilienhaus im Speckgürtel zu den Konditionen des geförderten Wohnbaus.
Aber 70 % der Österreicher wollen doch ein Einfamilienhaus?
AP: Natürlich, aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist kein reines Fachwissen mehr, dass das Einfamilienhaus von den Ressourcen her betrachtet, eine Katastrophe ist. Das wissen sogar die Häuslbauer schon. Der ‚Orasteig‘ ist eine Lösung, wie man individualisiertes Wohnen in verdichteter Form anbieten kann.
GP: Der großvolumige Wohnbau ist eine der Zukunftsaufgaben der Architekten, um möglichst viele Menschen in den Städten unterzubringen. Hier muss sich aber auch eine Individualität für den Nutzer abbilden.
Glauben Sie also an die Zukunftsprognosen, dass bald ein Großteil der Menschheit in den Städten leben wird?
AP: Daran glaube ich schon, aber auch an das Potenzial des Landes. Die Menschen sind ja Nomaden.
Inwieweit glauben Sie, dass die Nachverdichtung eine Lösung für die Städte der Zukunft ist?
AP: Auf jeden Fall ist das eine Lösung, wir haben einige Projekte in diesem Zusammenhang gemacht. Ein gutes Nachverdichtungsbeispiel ist der Dachbodenausbau in der Radetzkystraße.
Man kann auch die 50er Jahre, Nachkriegssiedlungen mit Nachverdichtung sehr gut erfrischen, indem man dadurch auch die sozialen Strukturen erneuert.
Kann Nachverdichtung ein Gewinn für die gesamte Nachbarschaft sein?
AP: Ja, natürlich.
Wieweit kann die Nachverdichtung gehen, bis zum Hochhaus? Was sagen Sie zum Ergebnis des Wettbewerbes für den WEV?
AP: Das finde ich eine unheimlich fade, traurige Entwicklung. Es gibt eine üble Tendenz zum kleinsten gemeinsamen Nenner, die Projekte werden immer gesichtsloser und unkonturierter, nicht zuletzt, weil die Stadtplanung in diesem Spiel kein selbstbewusster, fordernder Player ist.
Wurden da die Interessen des Investors bedient?
GP: Das Ergebnis ist traurig konservativ ausgefallen. Gäbe es ein Ergebnis, dass innovativ glaubwürdig ist, wäre der Widmungsgewinn zweitrangig. Obwohl ich eine Widmungsabgabe wie in Basel befürworte!
AP: Baukultur wird durch die Art wie die Wettbewerbe gegenwärtig laufen sicher nicht weiter gebracht.
PPAG architects
Anna Popelka und Georg Poduschka gründeten 1995 PPAG architects in Wien. Das Büro zählt heute 18 Mitarbeiter. PPAG betreute über 12 Jahre das Museumsquartier Wien und realisierte dort viele Projekte, darunter auch die Outdoorelemente Enzis. Einige Wohnbauten sozial relevanter Größe wurden realisiert, jeder mit eigenem Fokus. Zurzeit arbeitet PPAG u. a. am Bildungscampus Hauptbahnhof, an einem Wohnbau für die Seestadt Aspern und an einem Hybridgebäude in Deutsch Wagram. Soeben fertiggestellt wurden der Europan6-Wohnhügel in Simmering, die Fassade eines Parkhauses in Skopje/ Mazedonien und die Erweiterung einer Volksschule in Schattendorf/ Burgenland.