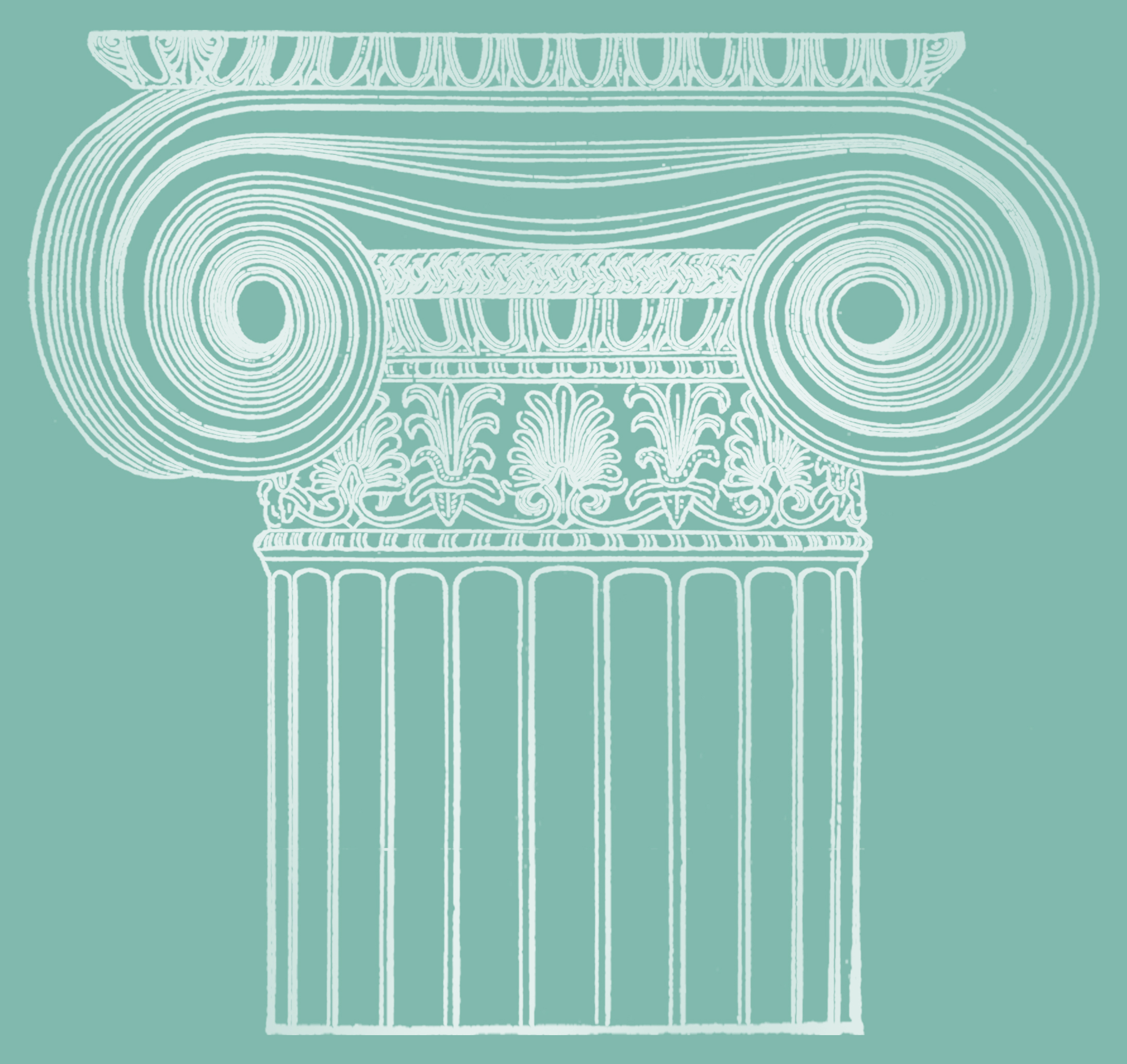Reinberg
Solararchitektur
© Steiner
architektur besuchte die Architekten Martha und Georg Reinberg in ihrem Atelier und fragte sie nach den Begriffen „Solararchitektur“ und „ökologisches Bauen“.
Herr Architekt Reinberg, wie würden Sie Ihre Architektur selbst bezeichnen?
Ist der Titel „Solararchitektur“ Ihrer Meinung nach der Richtige?
Am Beginn der Bewegung des ökologischen Bauens – in den frühen 1980er-Jahren – war das „der Begriff“, da ist die Solararchitektur aufgekommen. Ich finde es aber richtig, die Sonne nicht nur als Sinnbild der Solarnutzung, sondern auch als Symbol für eine neue Zukunft zu betrachten.
Finden Sie die Bezeichnung für Ihre Architektur zutreffend?
Ja! Weil er eine bestimmte Haltung ausdrückt. Meine grundsätzliche Überzeugung ist, dass es eine Zukunft gibt und dass mit Sonnenenergie im Bezug auf die Ökologie gebaut wird.
Was sollen die Menschen darunter verstehen?
Es ist sozusagen der positive Aufhänger, der mitteilt, dass es genügend Ressourcen gibt: Wir haben genug, wir müssen es nur nutzen. Der Begriff der Sonne ist ein Vehikel, um diese Idee zu transportieren.
Ist „immer spektakulärer, immer größer, immer schiefer“ die richtige Einstellung?
Ich habe eine sehr kritische Haltung gegenüber dieser derzeitigen Entwicklung in der Architektur. Eigentlich lehne ich dieses Trachten nach ikonenhaften Darstellungen in der Architektur ab. Das sind aus meiner Sicht eher verzweifelte Versuche, Sensationen zu erfinden, ohne sich mit unserer heutigen Zeit und ihren Wünschen und Hoffnungen ernsthaft auseinanderzusetzen. Wir entwickeln unsere Architektur aus Inhalten, nicht aus oberflächlichen Bildern.
Verzichten Sie dann in Ihrer Architektur auf Bilder?
Nein, es entstehen neue Bilder, die aber inhaltsbezogen sind. Wir bauen auch schiefe Häuser, aber die sind nicht aus Sensationsgründen schief, sondern weil das die Sonnennutzung optimieren kann. Unsere Formen sind interessant, weil sie inhaltlich stimmig sind und inhaltlich auf die heutigen Fragen Bezug nehmen. Unsere Arbeit ist es, die der heutigen Zeit und der Zukunft entsprechende Architektur zu finden. Nicht Bilder zu liefern, sondern Fragen zu beantworten. Das Wissen um unsere begrenzten Energieressourcen braucht neue Antworten. Auch die Ängste und Hoffnungen der Menschen brauchen Antworten, ebenso wie die Risiken des Klimawandels.
Wie rigoros sind Sie in dieser Haltung?
Soviel ich kann. Ich bin natürlich von einer heutigen Ökonomie – die ich aber nicht korrekt finde – limitiert.
Würden Sie einen Auftrag ablehnen, wenn er Ihrer Einstellung zuwiderläuft?
Ja schon, es kommt immer wieder vor, dass sich Dinge in eine ganz falsche Richtung entwickeln – das interessiert uns dann nicht. Aber Auftraggeber, die ganz anders denken als wir, kommen ohnehin nicht zu uns.
Gibt es für Sie ein moralisches Kriterium, eine Architektur zu bauen oder nicht zu bauen?
Es ist natürlich ein Unterschied, ob man rein formal zur Ehre und Verherrlichung einiger Diktatoren baut, oder auch dort Alternativen ein- und unterbringt. Man darf nicht die Macht des Architekten überschätzen. Ich muss auch viel schlucken, um überleben zu können. Es hat aber auch einen Grund, warum wir nicht gefragt werden, in Baku zu bauen.
Wie hat Sie die Zeit Ihres Studiums in Amerika beeinflusst?
In dieser Zeit (1974–75)war Österreich noch ziemlich verkorkst, kulturell geschlossen. Von Amerika habe ich die Aufbruchsstimmung mitgenommen, dort gab es schon damals Bioläden und die natürliche Geburt, die Hippie-Solararchitektur war in. Das hat schon viel Begeisterung in mir ausgelöst.
Sie haben auch unter Architekt Schweighofer gearbeitet?
Ich war bei Prof. Schweighofer am Institut für Gebäudelehre Assistent. Bei Schweighofer habe ich sehr viel von dem, was das Studium auf der TU nicht geboten hat, nachgeholt. Ich habe bei ihm sehr viel in puncto Entwerfen gelernt.
Es gibt eine Art Leitspruch von Ihnen: „Ökologische Architektur für alle!“ Wie interpretieren Sie in diesem Zusammenhang das „alle“?
Wir sind reich, es ist genug für alle vorhanden, um sehr gut zu leben. Es ist aber nicht genug vorhanden für die übermäßige Gier Einzelner.
Alle ist also im Hinblick auf die Ressourcen gemeint?
Alle können in einem gewissen Reichtum „leben“, genug zum Essen haben, Architektur genießen. Das ist auch ein Anspruch von uns: Wir wollen nicht nur für Eliten bauen, sondern wir suchen Lösungen, die allen ein besseres Leben ermöglichen.
Wenn man von einer „Solarbaubewegung“ spricht, was ist daran das Wichtigste: der pädagogische Aspekt, der Eigennutzen für die Benutzer, die Effizienz, die Nachhaltigkeit oder die Ästhetik?
Das Wichtigste in meiner Arbeit ist die Architektur selbst. Das ist mein Medium, meine Profession. Meine Frage ist, wie und wohin entwickelt sich die Architektur, die unsere gesellschaftlichen Fragen richtig beantwortet.
Was ist jetzt Solararchitektur?
Das ist die Architektur, von der ich glaube, dass es die dem Heute und unserer Gesellschaft entsprechende Architektur ist. Es ist der Versuch, meine Gedanken irgendwie in einen Begriff zu konzentrieren. Man kann das jetzt auch nachhaltige Architektur oder ökologisches Bauen nennen, Solararchitektur als Begriff ist mir nicht so wichtig. Das Wort bezieht sich nicht nur auf eine Technik, es ist auch eine Haltung. Nicht nur Energieoptimierung, sondern eine Sicht der Welt.
Arbeiten Sie beim Entwurf mehr mit dem Kopf oder der Intuition?
Das Entwerfen muss aus dem Bauch kommen. Es ist zu komplex – Bauaufgaben sind von so vielen Dingen mitbestimmt, dass man sie nicht nur rein rational lösen kann. Die Technik allein kann diese Komplexität nicht erfassen. Der Mensch kann auch kreativ denken und dadurch auch viel komplexer als irgendein Computer.
Gebäude zwischen Energie und Form – wie kann dieser Spagat kreativ bewältigt werden?
Den Satz „Form follows Energy“ haben wir schon sehr früh formuliert (z.B. in Zusammenhang mit der Schukowitzgasse). Brian Cody hat diesen auch in seinem kürzlich gehaltenen Vortrag verwendet. Wir hatten auch einmal – am Beginn unserer Arbeit – den Begriff „Ökologischer Funktionalismus“ vorgeschlagen. Aber diese Begriffe oder Versuche der sprachlichen Formulierung sind uns nicht so wichtig. Wichtiger ist uns die architektonische Formulierung.
Was halten Sie von der „grünen Architektur“?
Das ist auch einer dieser vielen, schnell wechselnden Begriffe. Vor sechs bis sieben Jahren war das ein Modebegriff. Er steht für naturnahes Bauen.
Aber ist es naturnahes Bauen, wenn ich Gras aufs Dach gebe?
Nein, das muss auch umfassender betrachtet werden, man muss beim Bauen die Umwelt möglichst wenig belasten. Wir haben z.B. bei einem unserer Bürobauten nach dem Bauen mehr Biomasse auf dem Grundstück als vorher und auch Vogelnistplätze realisiert; aber auch Naturmaterialien wie Holz, Stroh und Lehm wurden hier eingesetzt, und es ist ein Passivhaus.
Hundertwasser hat das vor vielen Jahren probiert und gemacht, aber damals hatten wir noch nicht die Nachhaltigkeitsdiskussion. Er hat damals eine Revolution ausgelöst.
Ja, mit seinem Verschimmelungsmanifest, das war sehr wichtig für die Architektur. Hundertwasser ist aber andererseits auch sehr problematisch: mit seinen Bauten hat er viel, was damals an echter ökologischer Architektur entstanden ist, verdeckt und schließlich „verkitscht“. Er hatte das Bild und den Begriff des „grünen Bauens“ total in der Öffentlichkeit besetzt.
Ist die Solararchitektur noch eine Nische am Markt?
Nicht mehr – laut Studien sind die drei wichtigsten Kriterien der Nutzerbedürfnisse nicht mehr die Lage, Lage, Lage, sondern ökologisches Bauen steht an erster Stelle. Das fragen die Nutzer sehr stark nach. Auch die ganzen Zertifikate sind ein Indikator dafür, dass die Entwicklung in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist.
Welche Schwerpunkte haben Sie in Ihrer Tätigkeit beim ökologischen Bauen, ist das der Wohnbau?
Wir bauen nun schon seit 30 Jahren. Anfangs haben wir fast nur Wohnbauten gemacht, weil die Nachfrage sehr stark aus diesem Bereich gekommen ist. In letzter Zeit ist der Anteil des Wohnbaus in unseren Aufträgen zurückgegangen. Ich würde gerne wieder einmal bei einem Bauträgerwettbewerb mitmachen, aber es ist nicht immer leicht, da auch hineinzukommen.
Was können Sie, sozusagen als „alter Hase“, den Jungen über Architektur vermitteln?
Ich kann aus den Erfahrungen erzählen, ich kann die Begeisterung, die ich habe, vermitteln. Und natürlich auch technisches Wissen. Ich denke, wir können auch eine hohe Glaubwürdigkeit vermitteln, da wir auch persönlich hinter unseren Konzepten stehen und versuchen sie zu leben.
Als ein Beispiel: Ich kaufe, wenn ich fliegen muss, ein CO2-Zertifikat. Das sind Grundsatzeinstellungen, die nicht nur auf Konsumoptimierung zielen. Ich wohne auch seit fast 30 Jahren in einem Haus, das ich selber gebaut habe – kein Einfamilienhaus, sondern ein sozialer Wohnbau.
Halten Sie energieautarke Gebäude für eine Chance oder eine Einbahnstraße oder eine Sackgasse?
So wie ich es sehe, ist es die einzige Lösung. Es ist ein Fehler, die Produktion von der Rekreation völlig zu trennen. Mein Ideal ist, Häuser die Energie produzieren, und zwar so viel Energie, dass man damit auch reisen kann. So könnte man die Energiefrage für die Zukunft lösen. Natürlich bedeutet das ein anders strukturiertes Netz der gesamten Verteilung. Was übrigens auch eine spannende städtebauliche Herausforderung ist.
Wenn ich an die Integration von Solarenergie in Gebäudestrukturen denke, die Paneele am Dach oder an der Fassade: Müssen wir uns – um energieschonend zu bauen und zu leben – von gewissen ästhetischen Wunschvorstellungen verabschieden? Bedeuten diese Trends nicht auch neue Gebäudeformen, also eineÄnderung der Bauordnungen?
Wir können nicht mehr mit den traditionellen Architekturvokabeln arbeiten. Das stößt an Grenzen. Altmodische Architekten setzen heute immer noch ihren Willen gegen die Bedürfnisse und Forderungen der ökologischen Architektur durch. Die Architektur ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, wo es toll war, wenn man schiefe Fenster gebaut hat. Die wirklich moderne und progressive Architektur ist für mich die Solararchitektur.
Ist der Gedanke des Verzichtens, der Reduktion, ein wesentlicher Bestandteil der Welt von morgen?
Nein, wir sehen das nicht so. Es ist kein Verzicht, sondern eine Bereicherung. Es ist ein Verzicht auf falsche Bilder. Es ist ja auch kein Verzichten, sich gesund zu ernähren. Es ist schmackhafter und wertvoller. Man bekommt nicht weniger, sondern mehr.
Die beste Energie ist die nicht gebrauchte Energie – stimmen Sie dem zu?
Ja! Und die Architektur kann diesbezüglich sehr viel leisten.
Stellen Sie sich die Welt von morgen mit oder ohne Menschen vor?
Wenn ich zynisch bin und man nur ökologisch denkt, dann ist es eine Welt ohne Menschen. Das Überleben der Ökologie ginge – wenn wir die heutige Situation betrachten – besser ohne Menschen. Ich denke natürlich im Sinne der Menschen und glaube, dass ein besseres Leben möglich ist. Der Mensch ist ja vom Grunde her ein Gemeinschaftswesen und nicht konkurrenzorientiert. Da findet ein Umdenken statt.
Würden Sie nochmals Architektur studieren, wenn Sie morgen am Inskriptionsschalter stünden?
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine interessante und eine unheimlich spannende Arbeit.
Architekt Georg W. Reinberg ist 1950 geboren, 1970–1976 Architekturstudium an der Technischen Universität Wien, 1973 Teilnahme an der Salzburger Sommerakademie (Prof. Bakema), 1976–1977 Fullbright Stipendiat an der Syracuse University, NY, 1977 Master Degree an der Syracuse University und 1978 Diplom an der TU Wien.
Er hat zunächst in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE Reinberg, Treberspurg, Raith 1984–1999) gearbeitet und ab 1992 auch Projekte alleine abgewickelt. Heute leitet Architekt Reinberg sein Büro gemeinsam mit seiner Frau Martha Enriquez-Reinberg.
Architekt Reinberg ist Gastprofessor an der Donau-Universität Krems, wo er 1997 bis 2010 auf den Abteilungen Solararchitektur, Sanierung und Facility Management unterrichtet hat. Darüber hinaus ist er auf der TU Wien und international als Vortragender tätig.
Zu den wichtigsten Bauten und Projekten gehören das Wohnprojekt Purkersdorf I–IV, die Siedlung Yachthafen Jois, ein Bürobau in Weidling, das Pflegeheim St.Pölten und die Kindergärten in Wien Schukowitzgasse und Deutsch Wagram.
Architekt Reinberg hat ca. 300 Projekte entworfen und mehr als 80 Projekte realisiert. Alle diese Projekte erfüllen hohe ökologische Ansprüche. Das Architekturbüro Reinberg ist in Entwurf, Planung und Ausführung (incl. Kosten und Baumanagement) tätig.